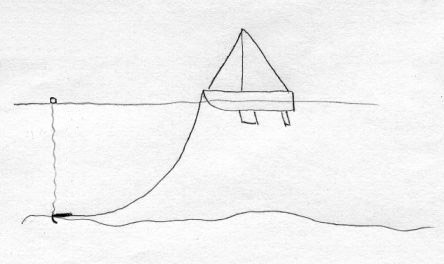Nautisches Lexikon - Anker-Komplikationen
Dies ist die Fortsetzung von
Ankermanövern.
 eider
gibt es eine ganze Reihe von Komplikationen, die den glatten Ablauf des Standardmanövers
verhindern und uns zu Zusatzmaßnahmen oder Ablaufänderungen zwingen. Das ist
fast eher die Regel als die Ausnahme. Zudem können die Komplikationen
kombiniert auftreten (mein größtes Ankerdesaster bisher hatte ich in einer engen
Bucht mit relativ steil ansteigendem Grund). eider
gibt es eine ganze Reihe von Komplikationen, die den glatten Ablauf des Standardmanövers
verhindern und uns zu Zusatzmaßnahmen oder Ablaufänderungen zwingen. Das ist
fast eher die Regel als die Ausnahme. Zudem können die Komplikationen
kombiniert auftreten (mein größtes Ankerdesaster bisher hatte ich in einer engen
Bucht mit relativ steil ansteigendem Grund). |
Die Komplikationen lassen sich klassifizieren:
- Beschränkter Raum (Hafen, volle Ankerbucht, sehr kleine Ankerbucht)
lässt einen nicht so viel Kette stecken, wie man eigentlich möchte.
- Starker Wind (Sturm, Fallwinde in einer Bucht mit hohen Bergen, Düseneffekt,
Kapeffekt) erfordert hohe Haltekraft (viel Kette) und läßt das Boot unruhig liegen
(Gieren vor Anker).
- Winddrehungen (Durchgang einer Front, Wetterwechsel) und wechselnde
Strömungsrichtungen (Tidengewässer) verändern die Lage des eigenen Schiffes
zu anderen Schiffen und zum Land. Dies kann zu Kontakt mit diesen Schiffen oder
dem Land führen oder den Anker "aus dem Grund drehen". Auch kann die vorher geschützte
Bucht auf einmal zur Falle werden.
- Schlechter Ankergrund (Schlick, Fels, Seetang, grober Kies oder Muscheln)
lässt das Ankermanöver zu einem Lotteriespiel werden.
- Unreiner Ankergrund (andere Ankerketten, Mooringketten, Autowracks,
Kabel zu Leuchttürmen und -tonnen, ...) lässt das Ankeraufholen zu einem Lotteriespiel
werden.
- Steiler Ankergrund (Ankerbucht nahe an tiefem Wasser, Flussufer) ist
eine oft unterschätzte und gefährliche Komplikation, die die Haltekraft des Ankers
sehr stark beeinflußt (siehe Einfluss
des Ankergrundverlaufs).
Die möglichen Gegenmaßnahmen für die genannten Komplikationen lassen sich
ebenfalls klassifizieren. Da sind zum einen die, die eher in der Planungs- und Entscheidungsphase
zum Tragen kommen:
- Ankermanöver besonders sauber fahren
- Alternativen Ankerplatz suchen
- Keinen Anker "gegen" einen steilen Grund ausbringen
Und dann die Gegenmaßnahmen, die zusätzliche Maßnahmen am gewählten Ankerplatz
beinhalten. Um die geht es hier. Einige benötigen als Voraussetzung einen weiteren
Anker an Bord (was bei Charteryachten durchaus nicht selbstverständlich ist):
- Schwojkreis begrenzen oder verhindern
- Lage des Bootes zum Wind fixieren (Gieren reduzieren oder unterbinden)
- Anker entlasten
- Ankerwache
- Flucht aus der Ankerbucht vorbereiten
- Trippleine verwenden
Die Gegenmaßnahmen im Einzelnen:
 chwojen
-- also das Kreisen des Schiffes um den Anker, wobei der Bug mehr oder weniger
in den (sich drehenden) Wind zeigt -- ist gut und richtig, denn ein Schiff,
das mit dem Bug in den Wind zeigt, belastet seinen Anker am wenigsten. Leider
wird der potentielle Schwojkreis um so größer, je mehr Kette gesteckt und je
stärker der Wind ist. Wenn man wenig Platz hat, muss man den Schwojkreis begrenzen,
entweder durch ein Reitgewicht (siehe unten) oder
durch "Vermuren" (einen zweiten Anker, der in diesem Fall allerdings nicht
die Haltekraft verbessert) -- oder einfach nur, indem man seinen Anker als Heckanker
ausbringt (Tipp von Georg Schlomka, vielen Dank): Heck voraus liegen die Schiffe
weitaus richtungsstabiler, speziell Langkieler. chwojen
-- also das Kreisen des Schiffes um den Anker, wobei der Bug mehr oder weniger
in den (sich drehenden) Wind zeigt -- ist gut und richtig, denn ein Schiff,
das mit dem Bug in den Wind zeigt, belastet seinen Anker am wenigsten. Leider
wird der potentielle Schwojkreis um so größer, je mehr Kette gesteckt und je
stärker der Wind ist. Wenn man wenig Platz hat, muss man den Schwojkreis begrenzen,
entweder durch ein Reitgewicht (siehe unten) oder
durch "Vermuren" (einen zweiten Anker, der in diesem Fall allerdings nicht
die Haltekraft verbessert) -- oder einfach nur, indem man seinen Anker als Heckanker
ausbringt (Tipp von Georg Schlomka, vielen Dank): Heck voraus liegen die Schiffe
weitaus richtungsstabiler, speziell Langkieler. |
Zum Vermuren legt man zwei Anker an zwei Ketten/Leinen aus, beide über das Buggeschirr,
aber in entgegengesetzte Richtungen:
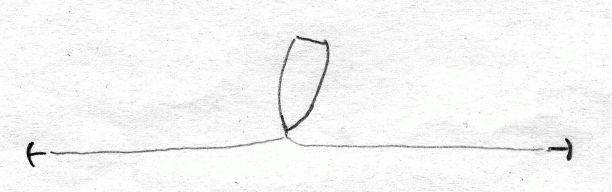
Der theoretische Minimalradius des Schwojkreises ist gleich der Schiffslänge,
praktisch ist er natürlich größer. Aber in jedem Falle ist er deutlich verkleinert.
Das Ausbringen des zweiten Ankers kann ein Problem werden, wenn die Kettenlängen
knapp bemessen sind. Dann muss man möglicherweise das Beiboot bemühen. Ansonsten
steckt man einfach beim ersten Anker die doppelte Kettenlänge, lässt den zweiten
Anker fallen und verholt sich dann wieder in Richtung erster Anker.
Probleme:
- Aufwendig. Ich habe das einmal gemacht, es war ein elendes Geschleppe. Der
Effekt war aber ganz OK. Würde es in einer entsprechenden Situation wieder
machen, hatte danach aber keine mehr ...
- Wenn sich das Schiff am Ankerplatz viel dreht, verdrillt man seine beiden
Ankerketten, was zu massiven Problemen beim Ankeraufholen führen kann.
 n
einer sehr engen Situation kann man das Schwojen ganz verhindern, indem man
das Schiff zwischen zwei Leinen "aufspannt", also den Buganker als Buganker
verwendet und den Heckanker als Heckanker. Oder aber ein Anker plus eine Leine zum Land. Kritisch sind dabei die unter
Ankern mit Bug- oder Heckleinen
genannten Punkte. n
einer sehr engen Situation kann man das Schwojen ganz verhindern, indem man
das Schiff zwischen zwei Leinen "aufspannt", also den Buganker als Buganker
verwendet und den Heckanker als Heckanker. Oder aber ein Anker plus eine Leine zum Land. Kritisch sind dabei die unter
Ankern mit Bug- oder Heckleinen
genannten Punkte. |
In britischen Flussrevieren mit Gezeiten (wechselnde Stromrichtung) findet
dieses Verfahren für feste Liegeplätze als "Mooring between piles" Anwendung:
Zwei Holzpfähle (piles) werden in den Boden gerammt und mit "Gleitstangen"
versehen, an denen die Festmacher im wechselnden Wasserstand nach oben und unten
gleiten können. Das Schiff wird längs zwischen diese Pfähle gelegt. Vorteil:
Wenig Aufwand beim Errichten, platzsparend. Nachteil: Kein Landgang ohne
Beiboot. Heute, in den etwas wohlhabenderen Zeiten, tendiert man auch dort zu
Schwimmstegen.
 ei
viel Wind (Sturm) bewegt sich ein üblicher Kurzkieler vor Anker in einem bestimmten
Rhythmus: ei
viel Wind (Sturm) bewegt sich ein üblicher Kurzkieler vor Anker in einem bestimmten
Rhythmus:
Anstatt immer geradlinig in der Verlängerung der Ankerkette zu liegen,
"tanzt" das Schiff hin und her. Das hat mehrere kombinierte Ursachen: |
- Auch ein Sturm weht in der Regel nicht konstant, sondern hat Böen und Flauten.
- Ein Kurzkieler lässt sich leicht um seinen kurzen Kiel drehen. Bei seitlichem
Winddruck auf das Schiff weicht der Bug als erstes aus, weil er am wenigsten Unterwasserschiff
hat (das Heck wird durch das Ruderblatt gebremst). Ohne Besegelung ist eine Lage
quer zum Wind der stabile Normalzustand (quasi beigedreht).
- Vor Anker kann sich ein Schiff drehen, weil die Ankerkette nur an einem Punkt
am Schiff befestigt ist, nämlich am Buggeschirr.
Damit ergibt sich folgendes Muster:
- Irgendwann einmal wird das Schiff von der etwas entlasteten, absinkenden Ankerkette
nach vorn gezogen. Der Zugwinkel der Kette am Bug ändert sich von "straff gespannt"
zu "nach unten zeigend".
- Wenn der Wind wieder zunimmt, kann die nach unten hängende Kette das Schiff
nicht halten, es kann sich relativ frei bewegen. Da der Wind praktisch nie direkt
von vorn kommt, wird er den Bug von der einen oder anderen Seite packen und das
Schiff drehen: Das Schiff "fällt ab" und wird versuchen, eine stabile Lage quer
zum Wind einzunehmen.
- Dabei kommt ihm aber nach kurzer Zeit die zunehmend straffer werdende Ankerkette
in die Quere, die den Bug wieder in den Wind zieht. In diesem Moment ist die Last
auf den Anker am größten: Das Schiff ist dem Winddruck von querab maximal ausgesetzt,
zieht mit großer Kraft an der Kette und strafft sie. Auch krängt das Boot seitlich.
- Die straff gespannte Ankerkette zieht den Bug in den Wind, wir "luven an".
In dieser Lage aber ist der Winddruck auf das Schiff geringer. Es kann dem Zug
der Kette nachgeben und wird von der absinkenden Kette wieder zum Anker gezogen
("in den Wind drehen").
- Allerdings befindet sich das Schiff weiter in seiner Drehbewegung. Es wurde
ja aus "quer zum Wind" in den Wind gedreht und dreht nun "über das Ziel hinaus".
Damit hat der Wind Gelegenheit, den Bug von der anderen Seite zu packen, dadurch
das Schiff noch weiter zu drehen, und das Spiel beginnt von vorn, dieses Mal auf
der anderen Seite.
Unangenehm sind neben dem abwechselnden Krängen des Schiffes, welches das Leben
an Bord erschwert, auch die Momente großer Belastung der Ankerkette. Eigentlich
möchte man lieber einen stetigen Zug auf die Kette haben. Und mit einer zusätzlichen
Leine am Heck kann man das auch erreichen:
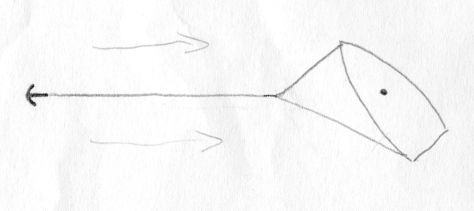
Diese Leine wird mit einem großen Stopperstek auf die Ankerkette gelegt und dann
auf die Heckklampe (oder eine Winsch) geführt. Die Entfernungen und Winkel muss
man je nach Schiff ausprobieren. Man blockiert auf diese Weise das "Drehgelenk"
der Ankerkette am Bugkorb, indem man ein geometrisch stabiles Dreieck aus Ankerkette,
Schiffslänge und Leine konstruiert, oder anders gesprochen: Über diese Hahnepot
wird das Schiff an zwei Punkten "am Anker aufgehängt", und zwar in einer Lage, die
nur das Abfallen nach einer Seite ermöglicht. Dazu kommt es aber gar nicht, die
Lage ist stabil: Das Abfallen wird von der eigentlichen Ankerkette verhindert, das
Anluven von der Leine. Unangenehm kann es werden, wenn die Situation so unruhig ist, dass das Schiff
doch mal auf die andere Seite übergeht. Dann passt es mit dem ganzen Tauwerk gar
nicht mehr. Diese Maßnahme würde ich z. B. nicht ergreifen, wenn ich von Bord gehen
will. Alternative: Die Heckleine durch einen ausgebrachten Zweitanker ersetzen,
also das Schiff tatsächlich "seitlich zum Wind an zwei Ankern fixieren".
Eine andere Alternative hat mir Rolf Jüngermann geschickt (vielen Dank dafür): Im achterlichen
Bereich des Schiffes eine größere Fläche "wie ein Segel" (parallel zur Mittschiffslinie)
aufspannen, also ein bis zwei Quadratmeter Tuch beispielsweise am Achterstag setzen
(oder am Besanmast, wenn man denn einen hat). Diese "Windfahne" stabilisiert ebenfalls
die Lage zum Wind:
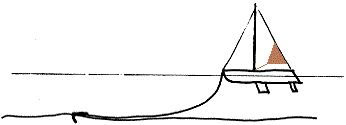
 in
technisch einfaches Manöver, das allerdings häufig an fehlendem Material
scheitert, denn man benötigt einen großen "Masseklumpen", der noch
handhabbar sein muss. Die Idee ist, an einem Punkt der gesteckten Ankerleine
(grob gesagt in der Mitte zwischen Anker und Buggeschirr) ein großes Gewicht
an die Kette zu hängen, welches die Kette an diesem Punkt auf den Grund
zieht. Dieses Gewicht lässt man aus praktischen Gründen häufig erst nach dem
vollendeten Ankermanöver an der gesteckten Kette nach unten gleiten wie eine
Seilbahngondel ins Tal. in
technisch einfaches Manöver, das allerdings häufig an fehlendem Material
scheitert, denn man benötigt einen großen "Masseklumpen", der noch
handhabbar sein muss. Die Idee ist, an einem Punkt der gesteckten Ankerleine
(grob gesagt in der Mitte zwischen Anker und Buggeschirr) ein großes Gewicht
an die Kette zu hängen, welches die Kette an diesem Punkt auf den Grund
zieht. Dieses Gewicht lässt man aus praktischen Gründen häufig erst nach dem
vollendeten Ankermanöver an der gesteckten Kette nach unten gleiten wie eine
Seilbahngondel ins Tal. |
Der Effekt ist in etwa derselbe, als wenn man eine viel dickere Ankerkette
verwenden würde: Bevor die Zugkraft des Bootes auf den Anker wirken kann, muss
sie erst mal das Reitgewicht vom Grund anheben, und auch dann läuft die Kette
immer noch in einem flacheren Winkel vom Anker weg als ohne Gewicht. Für diese Zweck gibt es extra Geschirre, die natürlich nie jemand an Bord hat,
zumal an Bord einer Charteryacht. Die Aufhängung kann man selbst improvisieren,
das Problem ist eher das geeignete Gewicht. Dabei muss man auch noch den Auftrieb
berücksichtigen: Wasserflaschen oder Konserven sind zwar schwer zu schleppen, eingetaucht
in Wasser wiegen sie aber kaum noch etwas. Am besten sind Blei oder Stahl, akzeptabel
Steine oder Sand, also z. B.:
- Der Zweitanker
- Stahlschrott
- Ein Felsbrocken
- Viele Backsteine
- Im Notfall: Die Batterien ...
Praktisch kann es sehr schwierig sein, einen Felsbrocken so mit Tau zu umwickeln,
dass er sich nicht aus der Verschnürung rausarbeitet oder rausrutscht. Am besten
wäre ein starkes Netz. Schon aus diesem Grund ist der Zweitanker ein ganz gutes
Reitgewicht, denn er hat eine Aufhängung. Er steht dann allerdings nicht mehr für
die Maßnahme "Anzahl der Anker erhöhen" zur Verfügung, wo er vielleicht einen besseren
Dienst leisten könnte.
Dieses Reitgewicht muss über eine großzügig dimensionierte "Öse" auf der Kette
zum Meeresgrund gleiten können, geführt von einem zusätzlichen Tau:
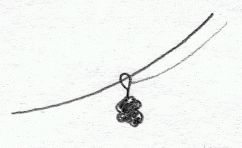
Wenn man das Gefühl hat, dass das Reitgewicht zu nah am Buggeschirr und zu weit
weg vom Anker zu liegen kommt, dann muss man die Ankerkette zunächst verkürzen,
das Reitgewicht weiter vorrutschen lassen und anschließend wieder Kette stecken.
 ie
Idee ist, die auf das Boot wirkende Kraft gleichzeitig auf zwei Anker zu verteilen,
die an verschiedenen Stellen des Grundes, aber beide in Windrichtung liegen.
Das kann über einunddieselbe oder zwei Ankerketten erfolgen. Die Ausführung
des Manövers wird wesentlich dadurch bestimmt, wie viel Raum man am Ankerplatz
hat. ie
Idee ist, die auf das Boot wirkende Kraft gleichzeitig auf zwei Anker zu verteilen,
die an verschiedenen Stellen des Grundes, aber beide in Windrichtung liegen.
Das kann über einunddieselbe oder zwei Ankerketten erfolgen. Die Ausführung
des Manövers wird wesentlich dadurch bestimmt, wie viel Raum man am Ankerplatz
hat. |
- Man macht "ein zweites Ankermanöver" und bringt den zweiten Anker V-förmig
genauso weit wie den ersten Anker aus. V-förmig deshalb, damit sich die beiden
Anker nicht behindern.
- Alternativ bringt man beide Anker in gleicher Linie aus, aber den zweiten
an kürzerer Kette, so dass sie sich ebenfalls nicht behindern.
- Bei Kettenmangel kann man den Zweitanker auch in die Kette des ersten Ankers
mit einhängen. Ich würde dem aber in der Regel die 2. Variante mit einer Leine
vorziehen.
 antasie ist auch im Notfall gefragt. antasie ist auch im Notfall gefragt.
Kompetenz zeichnet
sich ja gerade auch durch das Beschreiten neuer Wege aus.
Zwei Anregungen hierzu: |
Zusätzliche Leine an Land
Wenn die räumlichen Umstände günstig sind und man noch eine Chance hat, ohne
Lebensgefahr mit dem Dinghi an Land zu kommen, dann kann man den Anker auch dadurch
entlasten, dass man eine lange Leine zum Ufer ausbringt und dort an einem Baum oder
irgendeinem anderen geeigneten Gegenstand "ankert" -- und sei es nur als Rückfalloption,
falls der Anker nicht hält.
Gegenan dieseln
Falls man kein Treibstoff- und auch kein Crewproblem hat, dann kann man einen
Schichtbetrieb am Ruder aufnehmen und mit wenig Gas in Richtung Anker dieseln und
ihn so entlasten.
 eichter
gesagt als getan. eichter
gesagt als getan.
Eine (nächtliche) Ankerwache hat so viele Nachteile, dass
sie ein Notfallmanöver bleiben muss und vorher alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft
werden sollten. |
- Sie ist anstrengend. Gegen jeden Biorhythmus versucht man, ohne eine konkrete
Handlungsaufgabe wach zu bleiben. Man muss ja "nur" aufpassen. Hierbei die Balance
zu halten zwischen unnötiger Alarmierung des Körpers und wohligem Wegschlummern,
ist etwas für charakterstarke Naturen. Auf schwach bemannten Schiffen kann sie
zur gefährlichen Übermüdung der ganzen Crew führen, wenn z. B. nach einem anstrengenden
Tag die beiden Crewmitglieder jeweils auf ihren halben Nachtschlaf verzichten
müssen.
- Man müsste sie eigentlich an Deck halten, denn nur dort sieht man in der Regel,
wo man sich befindet und was Schiff und Anker so anstellen. Das ist aber bei Wind,
Kälte, Nässe und Dunkelheit alles andere als einladend. Deshalb ist man versucht,
sie unter Deck zu halten und verpasst so womöglich den entscheidenden Moment (selbst
erlebt ...).
- Sie kann einen in falscher Sicherheit wiegen. Angenommen, es kommt wirklich
dazu, dass der Anker nicht hält, sondern das Schiff ihn langsam durch die Bucht
zieht. Es zu bemerken, hilft ja noch nicht viel: Es gilt zu handeln. Dazu müssen
meist andere geweckt werden, in ihre Kleider steigen, sich orientieren etc. Auf
diese Weise kann wertvolle Zeit verlorengehen, und dann kollidiert man doch mit
einem achterlich liegenden Schiff, dessen Anker gehalten hat.
Eine brauchbare Alternative kann sein, in regelmäßigen Zeitabständen nach
der Lage zu schauen und dazwischen zu schlafen. Diese Zeitpunkte sollten sinnvoll
gewählt sein, in einem Gezeitenrevier z. B. das Kentern des Stromes oder bei erwartetem
Frontdurchgang der hierfür erwartete Zeitpunkt.
Besser also, wenn man sich auf seinen Anker verlassen kann. Mein Standpunkt:
Lieber zwei Stunden lang Ankermanöver bis zum Erfolg fahren, als Ankerwache zu halten.
Dabei ist auch der Lerneffekt höher.
 enügend Fälle sind
bekannt, wo Ankerbuchten auf einmal zur gefährlichen Falle
geworden sind. Die Ursachen können vielfältig sein. Man kann dann seinen Handlungsspielraum
bewahren, indem man sich -- möglichst noch bei Tageslicht -- ein genaues Bild
der Geografie der Bucht macht, Landmarken für die Ausfahrt notiert und kritisch
überlegt, ob das auch im Dunkeln ein gangbarer Weg ist. enügend Fälle sind
bekannt, wo Ankerbuchten auf einmal zur gefährlichen Falle
geworden sind. Die Ursachen können vielfältig sein. Man kann dann seinen Handlungsspielraum
bewahren, indem man sich -- möglichst noch bei Tageslicht -- ein genaues Bild
der Geografie der Bucht macht, Landmarken für die Ausfahrt notiert und kritisch
überlegt, ob das auch im Dunkeln ein gangbarer Weg ist. |
 rippleinen (engl. tripping line) sind ein "Notausgang" aus einem missglückten
Manöver, bei dem der Anker am Grund festgekommen ist. Die Form fast aller Anker
prädestiniert sie leider dazu, sich mit einer Flunke oder der Pflugschar unter
irgendeinem Gegenstand zu verhaken. Die Lösung wäre, "den Anker rückwärts zu
bewegen", aber leider kann die Ankerkette nur in eine Richtung ziehen, nämlich
noch tiefer ins Verderben. rippleinen (engl. tripping line) sind ein "Notausgang" aus einem missglückten
Manöver, bei dem der Anker am Grund festgekommen ist. Die Form fast aller Anker
prädestiniert sie leider dazu, sich mit einer Flunke oder der Pflugschar unter
irgendeinem Gegenstand zu verhaken. Die Lösung wäre, "den Anker rückwärts zu
bewegen", aber leider kann die Ankerkette nur in eine Richtung ziehen, nämlich
noch tiefer ins Verderben. |
Die Trippleine ermöglicht diese Rückwärtsbewegung des Ankers, indem sie gegenüber
der Ankerkette an der Krone angebracht ist. Häufig ist es ausreichend, die Ankerkette
zu entlasten und statt dessen an der Trippleine zu ziehen, um den Anker "kentern
zu lassen" und kopfüber zu bergen. Dazu muss die Trippleine recht kräftig sein,
ein dünnes Bändsel reicht da nicht. Sie sollte NICHT schwimmfähig sein, um nicht
über längere Strecken an der Wasseroberfläche zu schwimmen, wo sie leicht einem
Motorboot zum Opfer fallen kann (oder umgekehrt ein Motorboot ihr zum Opfer fallen
kann).
Eine Trippleine ist lästig. Um von ihr zu profitieren, muss sie beim Ankermanöver
immer auf Verdacht mit ausgebracht werden. Um ihr freies Ende packen zu können,
muss sie entweder zum Schiff zurückgeführt sein, oder aber man lässt sie in einer
kleinen Ankerboje enden. Einen sehr hübschen Trick hat mir W. Jürgen Hardt zugeschickt (herzlichen Dank):
Man lässt die Trippleine parallel zur Ankerkette ausrauschen, und wenn sie (z. B.
nach 20 Metern) zuende ist, dann knotet man sie in ein gerade passendes Kettenglied,
sichert also sozusagen das Trippleinen-Ende an der Ankerkette selbst. Denn egal
wie unklar der Anker kommt: Bis zu dem Punkt, wo das Trippleinen-Ende eingeknotet
ist, kann man die Kette immer aufholen. Dort löst man dann seine Trippleine und
kann ganz normal über sie verfügen
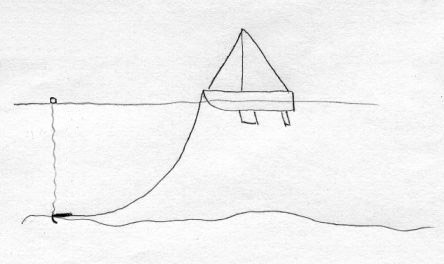
Das mit der Ankerboje ist der bei weitem elegantere Weg, denn damit verhindert
man mehrere Probleme:
- Wenn eine zum Schiff zurückgeführte und festgemachte Trippleine zu kurz bemessen
wurde, dann kann sie bei einem Straffen der Ankerkette ungewollt in Aktion treten.
Sie übernimmt anstelle der Ankerkette die Zuglast und zieht damit den Anker aus
dem Grund ...
- Beim Schwojen kann sie sich um die Ankerkette wickeln und dabei durch zuviel
Reibung im Notfall wirkungslos werden: Man zieht mit ihr nicht an der Ankerkrone,
sondern an der Kette. Im Extremfall kann sie sich durch die zusätzlichen Windungen
auf der Ankerkette soweit verkürzen, dass sie auch hier den Anker aus dem Grund
zieht.
- Man kann sie mit der Ankerboje in einem relativ frühen Stadium des Ankermanövers
über Bord geben und sich dann weiter auf das eigentliche Manöver konzentrieren.
Auch beim Ankeraufholen stört sie den Ablauf erst relativ spät.
Ankerbojen wiederum haben andere Ärgernisse:
- Motorschiffe können sie samt Leine in die Schraube bekommen.
- Wenn die Leine zu kurz bemessen ist, verschwindet die ganze Geschichte bei
Hochwasser in den Fluten.
 eider
gibt es eine ganze Reihe von Komplikationen, die den glatten Ablauf des Standardmanövers
verhindern und uns zu Zusatzmaßnahmen oder Ablaufänderungen zwingen. Das ist
fast eher die Regel als die Ausnahme. Zudem können die Komplikationen
kombiniert auftreten (mein größtes Ankerdesaster bisher hatte ich in einer engen
Bucht mit relativ steil ansteigendem Grund).
eider
gibt es eine ganze Reihe von Komplikationen, die den glatten Ablauf des Standardmanövers
verhindern und uns zu Zusatzmaßnahmen oder Ablaufänderungen zwingen. Das ist
fast eher die Regel als die Ausnahme. Zudem können die Komplikationen
kombiniert auftreten (mein größtes Ankerdesaster bisher hatte ich in einer engen
Bucht mit relativ steil ansteigendem Grund).  chwojen
-- also das Kreisen des Schiffes um den Anker, wobei der Bug mehr oder weniger
in den (sich drehenden) Wind zeigt -- ist gut und richtig, denn ein Schiff,
das mit dem Bug in den Wind zeigt, belastet seinen Anker am wenigsten. Leider
wird der potentielle Schwojkreis um so größer, je mehr Kette gesteckt und je
stärker der Wind ist. Wenn man wenig Platz hat, muss man den Schwojkreis begrenzen,
entweder durch ein Reitgewicht (
chwojen
-- also das Kreisen des Schiffes um den Anker, wobei der Bug mehr oder weniger
in den (sich drehenden) Wind zeigt -- ist gut und richtig, denn ein Schiff,
das mit dem Bug in den Wind zeigt, belastet seinen Anker am wenigsten. Leider
wird der potentielle Schwojkreis um so größer, je mehr Kette gesteckt und je
stärker der Wind ist. Wenn man wenig Platz hat, muss man den Schwojkreis begrenzen,
entweder durch ein Reitgewicht (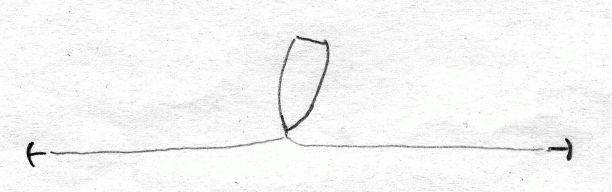
 n
einer sehr engen Situation kann man das Schwojen ganz verhindern, indem man
das Schiff zwischen zwei Leinen "aufspannt", also den Buganker als Buganker
verwendet und den Heckanker als Heckanker. Oder aber ein Anker plus eine Leine zum Land. Kritisch sind dabei die unter
n
einer sehr engen Situation kann man das Schwojen ganz verhindern, indem man
das Schiff zwischen zwei Leinen "aufspannt", also den Buganker als Buganker
verwendet und den Heckanker als Heckanker. Oder aber ein Anker plus eine Leine zum Land. Kritisch sind dabei die unter
 ei
viel Wind (Sturm) bewegt sich ein üblicher Kurzkieler vor Anker in einem bestimmten
Rhythmus:
ei
viel Wind (Sturm) bewegt sich ein üblicher Kurzkieler vor Anker in einem bestimmten
Rhythmus: 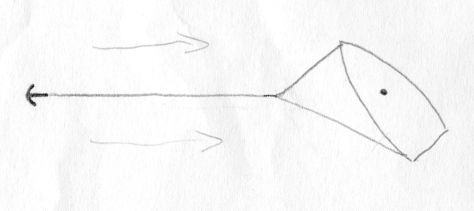
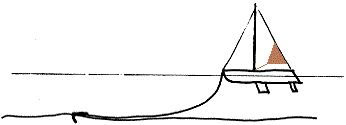
 in
technisch einfaches Manöver, das allerdings häufig an fehlendem Material
scheitert, denn man benötigt einen großen "Masseklumpen", der noch
handhabbar sein muss. Die Idee ist, an einem Punkt der gesteckten Ankerleine
(grob gesagt in der Mitte zwischen Anker und Buggeschirr) ein großes Gewicht
an die Kette zu hängen, welches die Kette an diesem Punkt auf den Grund
zieht. Dieses Gewicht lässt man aus praktischen Gründen häufig erst nach dem
vollendeten Ankermanöver an der gesteckten Kette nach unten gleiten wie eine
Seilbahngondel ins Tal.
in
technisch einfaches Manöver, das allerdings häufig an fehlendem Material
scheitert, denn man benötigt einen großen "Masseklumpen", der noch
handhabbar sein muss. Die Idee ist, an einem Punkt der gesteckten Ankerleine
(grob gesagt in der Mitte zwischen Anker und Buggeschirr) ein großes Gewicht
an die Kette zu hängen, welches die Kette an diesem Punkt auf den Grund
zieht. Dieses Gewicht lässt man aus praktischen Gründen häufig erst nach dem
vollendeten Ankermanöver an der gesteckten Kette nach unten gleiten wie eine
Seilbahngondel ins Tal. 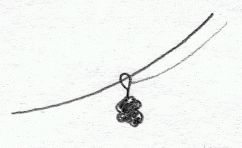
 ie
Idee ist, die auf das Boot wirkende Kraft gleichzeitig auf zwei Anker zu verteilen,
die an verschiedenen Stellen des Grundes, aber beide in Windrichtung liegen.
Das kann über einunddieselbe oder zwei Ankerketten erfolgen. Die Ausführung
des Manövers wird wesentlich dadurch bestimmt, wie viel Raum man am Ankerplatz
hat.
ie
Idee ist, die auf das Boot wirkende Kraft gleichzeitig auf zwei Anker zu verteilen,
die an verschiedenen Stellen des Grundes, aber beide in Windrichtung liegen.
Das kann über einunddieselbe oder zwei Ankerketten erfolgen. Die Ausführung
des Manövers wird wesentlich dadurch bestimmt, wie viel Raum man am Ankerplatz
hat. antasie ist auch im Notfall gefragt.
antasie ist auch im Notfall gefragt.
 enügend Fälle sind
bekannt, wo Ankerbuchten auf einmal zur gefährlichen Falle
geworden sind. Die Ursachen können vielfältig sein. Man kann dann seinen Handlungsspielraum
bewahren, indem man sich -- möglichst noch bei Tageslicht -- ein genaues Bild
der Geografie der Bucht macht, Landmarken für die Ausfahrt notiert und kritisch
überlegt, ob das auch im Dunkeln ein gangbarer Weg ist.
enügend Fälle sind
bekannt, wo Ankerbuchten auf einmal zur gefährlichen Falle
geworden sind. Die Ursachen können vielfältig sein. Man kann dann seinen Handlungsspielraum
bewahren, indem man sich -- möglichst noch bei Tageslicht -- ein genaues Bild
der Geografie der Bucht macht, Landmarken für die Ausfahrt notiert und kritisch
überlegt, ob das auch im Dunkeln ein gangbarer Weg ist. rippleinen (engl. tripping line) sind ein "Notausgang" aus einem missglückten
Manöver, bei dem der Anker am Grund festgekommen ist. Die Form fast aller Anker
prädestiniert sie leider dazu, sich mit einer Flunke oder der Pflugschar unter
irgendeinem Gegenstand zu verhaken. Die Lösung wäre, "den Anker rückwärts zu
bewegen", aber leider kann die Ankerkette nur in eine Richtung ziehen, nämlich
noch tiefer ins Verderben.
rippleinen (engl. tripping line) sind ein "Notausgang" aus einem missglückten
Manöver, bei dem der Anker am Grund festgekommen ist. Die Form fast aller Anker
prädestiniert sie leider dazu, sich mit einer Flunke oder der Pflugschar unter
irgendeinem Gegenstand zu verhaken. Die Lösung wäre, "den Anker rückwärts zu
bewegen", aber leider kann die Ankerkette nur in eine Richtung ziehen, nämlich
noch tiefer ins Verderben.